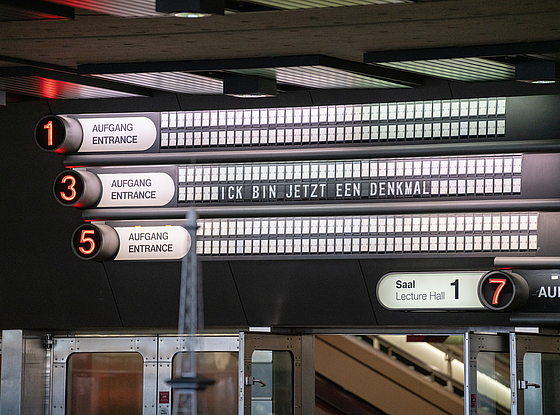Auch in diesem Jahr ist das Haus der Kulturen der Welt Schauplatz der Transmediale, eines der größten Festivals für Kunst und digitale Medien weltweit. Gezeigt werden vom 28. Januar bis 1. Februar neue und bedeutende Projekte der digitalen Kultur und Reflexionen über die gesellschaftliche Rolle digitaler Technologien. Unter dem Titel „Deep North“ lenkt das Festival den Blick der Besucher auf die Phänomene des Klimawandels mit seinen kulturellen, gesellschaftlichen und philosophischen Konsequenzen. Das dichte Festivalprogramm, bestehend aus Konferenzen, Workshops, Diskussionen, Performances und Ausstellungen bietet Gelegenheit, neue Formen der Präsentation, der Kommunikation und des Handelns aufzuzeigen. Die Folgen des Klimawandels sind ebenfalls Thema des diesjährigen Transmediale-Wettbewerb, für den über 900 künstlerische Arbeiten aus 53 Ländern eingereicht wurden. Eine internationale Jury wählte acht Nominierungen für den mit insgesamt 8.000 Euro dotierten Transmediale Award 2009 aus. Projekt Zukunft sprach mit Stephen Kovats, dem Architekten und künstlerischen Leiter der Transmediale, über die Bedeutung der Transmediale, die Notwendigkeit solcher Festivals und den Wunsch, die unsichere Struktur der Transmediale stabiler zu machen.
Die Transmediale gibt es seit 20 Jahren. Wie wird sie wahrgenommen und wie unterscheidet sie sich von anderen Festivals, zum Beispiel der Ars Electronica?
Kovats: Die Transmediale wird als multidisziplinäre Veranstaltung wahrgenommen, welche die ganze Bandbreite an digitaler Kultur aufnimmt – die soziopolitischen, technologischen und wissenschaftlichen Aspekte. Das ist das Spezielle an der Transmediale, und das macht gleichzeitig den Unterschied zu anderen ähnlichen Veranstaltungen aus.Die Transmediale wird sehr oft mit der Ars Electronica verglichen, weil wir ähnliche Felder abdecken und weil beide Festivals zu den ältesten ihrer Art gehören. Von außen betrachtet, sind die Festivals von der Struktur, Professionalität und Ausstrahlung her sehr ähnlich. Die Transmediale ist aber thematisch spezifischer. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist, dass die Ars Electronica sehr stark von der Stadt Linz und dem Österreichischen Rundfunk gefördert wird. Das Festival wird als wichtiger Bestandteil der Kulturproduktion in Österreich angesehen und man fühlt förmlich den Stolz von Seiten der Industrie und den Förderern. Die Transmediale hingegen gilt zu Hause immer noch als alternativ und schwer zugänglich. Dabei kommen aus ganz Deutschland und aus allen Ecken der Welt Leute wegen der Transmediale nach Berlin. Die Unterstützung, welche die Transmediale in der Hauptstadt erfährt, könnte sicherlich etwas stärker sein.
Die Transmediale findet kurz vor der Berlinale statt und startete ursprünglich als eine Art "Gegenveranstaltung" zu ihr. Welche Bedeutung hat die Transmediale heute für Berlin?
Kovats: Eine Gegenveranstaltung ist die Transmediale auf keinen Fall mehr. Sie ist heute ein etabliertes Festival, das eine partnerschaftliche Beziehung zur Berlinale pflegt. In den 80er Jahren gab es noch keinen Raum für unabhängige Videokunst und für Underground Filmproduktionen. Die Foren entstanden aus der kulturellen Notwendigkeit heraus. Die Transmediale hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und steht heute auf eigenen Füßen. Dass Berlinale und Transmediale zeitlich nah beieinander stattfinden, ist für unser Festival nicht maßgeblich. Aber es bringt die Menschen dazu zu sagen: „Ja, wir kommen nach Berlin, weil zwei Dinge stattfinden.“ Das fördert auf jeden Fall die mediale Ausstrahlung von Berlin im Kunst und Kultursektor.
Wie sieht die Zusammenarbeit der Transmediale mit Berliner Partnern aus?
Kovats: Mir ist sehr wichtig, dass die Transmediale ein starkes Netzwerk mit interessanten Einrichtungen in Berlin pflegt. Wir wollen konkrete Partnerschaften eingehen, die inhaltlichen Zwecken dienen: Beispielsweise haben wir in Zusammenarbeit mit dem Vilém Flusser Archiv an der Universität der Künste den „ Vilém Flusser Theory Award“ gegründet, der theoretische, kritische und künstlerische Arbeiten auszeichnet. Damit bekommt gleichzeitig das in Berlin ansässige Archiv etwas Aufmerksamkeit, welches das Werk des relativ unbekannten, aber einer der wichtigsten Medienphilosophen des 20. Jahrhunderts, bewahrt. Und mit dem öffentlich zugänglichen Marshall McLuhan Salon der kanadischen Botschaft in Berlin haben wir die jährlich stattfindende „Marschall McLuhan Lecture“ gegründet. Auch das Collegium Hungaricum Berlin ist ein interessanter Partner für uns, weil es die Relation zwischen Kunst und Technologie unterstützt. Dass das volle Werk und Archiv von Vilém Flusser und ein Informationszentrum über Marshall McLuhan in Berlin ansässig sind, ist etwas ganz besonderes und das gibt sozusagen die konzeptionelle Ausrichtung der Transmediale wieder.
Die Transmediale hat viele innovative Projekte als erstes entdeckt und vorgestellt. Was ist aus ihnen geworden?
Kovats: Wir präsentieren oft Dinge, die das Publikum so noch nicht gesehen hat, in verschiedenen Formaten und Formen und aus den unterschiedlichsten aktuellen Positionen heraus. Das prägt den leicht instabilen und schwierigen Charakter der Transmediale, denn wir befinden uns in einem sich stark ändernden technologischen Kontext. Manchmal wird ein Kunstwerk, das auf der Transmediale gefeiert wird, als solches in dem Moment nicht wahrgenommen. So geschehen mit dem interaktiven Soundkunstwerk „reacTable“, das auf der Transmediale 2007 zu sehen war. Im September 2008 hat es auf der Ars Electronica die „Goldene Nica“ bekommen, eine Auszeichnung, die dem Oscar für die weltweite Medienkunstszene entspricht. Nun will auch Sony mit den Künstlern verhandeln. Wenn man sich in seiner täglichen Arbeit mit Zukunft befasst, beschäftigt man sich mit dem Unbekannten. Andere Festivals gehen vielleicht eher auf Nummer sicher, weil sich mit bewährten, bekannten Künstlern die Sache einfacher verkaufen lässt. Wir kommen mit neuen, manchmal scheinbar abgefahrenen Sachen daher. Und das ist eines der Gründe, warum es die Transmediale gibt: Ein Forum für „das Neue“ zu haben ist wichtig und notwendig. Wir müssen weitergraben, dahinter schauen und kulturelle Risiken in der Arbeit einfangen.
Welche Zukunftspläne haben Sie für die Transmediale?
Kovats: Die Transmediale soll genau so weiterwachsen, auch inhaltlich. Das ist eine Herausforderung, gerade wenn man in einem instabilen gesellschaftlichen und technologischen Umfeld arbeitet. Wir können die Zukunft nicht voraussagen. Doch ich möchte, dass die Transmediale die wichtigsten Themen, die unsere technologische und digitale Kultur berühren, thematisch umsetzt. Es geht nicht nur darum, das tollste Kunstwerk zu finden, sondern dass wir die Dinge, die in unserem Leben passieren, auch in einen gesellschaftlichen Zusammenhang bringen, gerade weil wir soviel mit Medienkultur, digitaler Technologie und dergleichen in unserem Alltag zu tun haben.Ich hoffe, dass wir die Struktur der Transmediale in eine stabilere Lage bringen werden. Derzeit haben wir instabile Strukturen, beispielsweise hinsichtlich der Förderungen, und wir arbeiten in einem instabilen künstlerischen und kulturellen Kontext. Mein Ziel ist es, der Transmediale ein Fundament zu geben, damit die auch für Berlin wichtige Arbeit besser, stärker und langfristig umgesetzt werden kann.